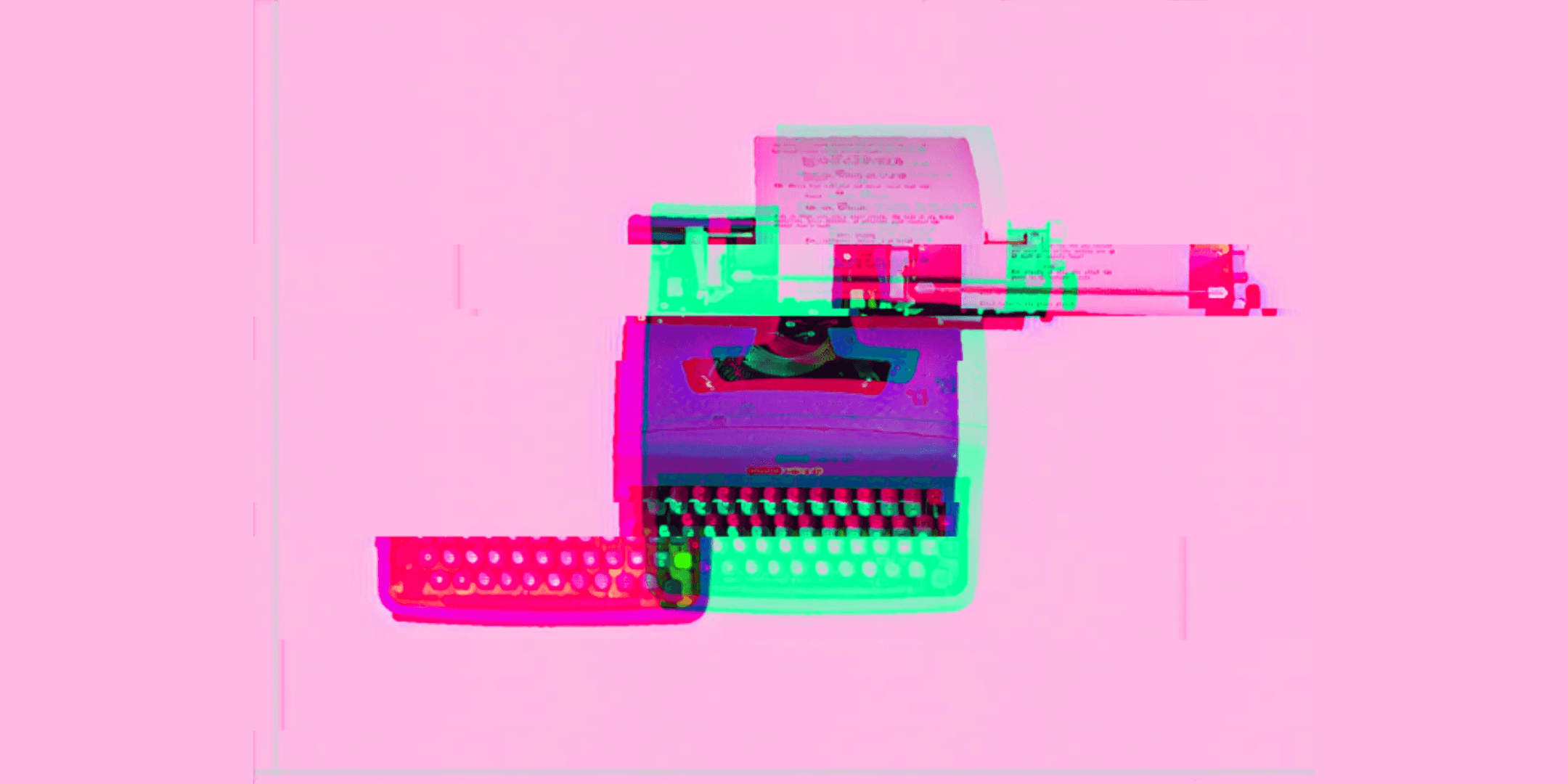Ein Teil dieses Kolumnenschreibens ist, wie ich in meiner Absichtserklärung erläuterte, dass ich es als eine Schreibübung ansehe. Als einen Versuch, dieses Medium zu erforschen und einen eigenen Stil für mein literarisches Schreiben ausfindig zu machen. Ein wesentlicher Bestandteil war meine anfängliche Entscheidung, nahezu Autobiografisch Sachverhalte aufzubereiten. Mir beispielsweise gesellschaftliche Wesenszüge zu erlesen, diese in Bezug zu wahren Vorkommnissen in meinem Leben zu setzen, um sie – eingebettet in meine Geschichte – darzulegen. Dies geschieht nicht ohne den Versuch, den Lesenden von meinem Standpunkt zu überzeugen, und ist gerade aufgrund des autobiografischen Stils auch nicht davon zu trennen – geschweige denn, dass dies überhaupt gewollt ist.
Dieses literarische Schreiben, der Ausdruck meiner Selbst durch eine präzise-kuratierte Auswahl von Worten und Satzkonstellationen, bedeutet mir viel. Dies mag man als kleinen Zwischenstand dieses Schreiprozesses der vergangenen Kolumne ansehen. Es ermöglicht mir, einen neuen, meiner Person sehr nahem, kreativen Ausdruck, aber auch die Beschäftigung mit neuen Interessensgebieten, oder die Festigung mir bereits Bekanntem. Zudem eröffnet es mir, zu präzisieren, welche Wege sich nach einem Philosophie und Musikwissenschafts-Studium darbieten. Eine Frage, die Teil der Essenz eines solchen ist und zumeist unbeantwortet bleibt.
Nach einer kleinen, ungenauen, sinnsuchenden und nahezu depressiv klingenden Einleitung wollen wir uns vielleicht noch einmal verdeutlichen, wo die Chancen dieses Geschichtenerzählens liegen. Nicht bloß diejenigen für mein eigenes privilegiertes Wohl, sondern die Bedeutung für die Zuhörenden oder Lesenden. So wollen wir uns – nach diesem starken, gedanklichen Bruch, oder der misslungenen Überleitung, je nachdem, was man hier die Schuld geben möchte – dem narrativen Erzählen. Also einem Begriff oder einem Thema, das die Feuilletons der Welt der letzten Jahrzehnte zierten, deren einzige Daseinsberechtigung ausmachte und dessen inflationärer Gebrauch jegliche erste Abwehrmechanismen eurerseits rechtfertigt.
Wir sehen uns umgeben von strategisch-geplanten Geschichten. Beispielhaft: Ich betrete, in dringender Not für ein Geburtstagsgeschenk, den lokalen Spirituosen-Händler. Auch entgegen meiner Apathie für Alkoholgeschenke – die meine Mutter mir repetitiv einzubläuen versuchte und als unmoralisch zu brandmarken versuchte – hielt ich diese Wahl meist für die Einfachste. Ich bin nicht sonderlich gut im Schenken. An der Kasse sitzt ein ahnungsloser Anfangzwanziger, der sich mit diesem Minijob das Studium finanziert. Er muss kein Experte für die verschiedenen Produkte im Laden sein. Die unzähligen, gut durchdesignten Produktbroschüren – die mehr Romanen als Beipackzetteln ähneln – erledigen diesen Job und ermöglichen mir einen unendlichen Einblick in die verschiedensten Destillerien, langatmigen Familiengeschichten, akribischen Produktbeschreibungen, die einem präzisen Rezept nahekamen und Geschmackspaletten, die mir die grausige Aufgabe des selber Schmeckens und Deutens abnahmen, wodurch ich mich voll und ganz auf den mannigfachen Konsum konzentrieren kann. Selbstverständlich wurde die schönst gestaltete Flasche Limoncello, mit dem schönsten und literarisch-ansprechenden Beiheft gewählt. Die strategische Erzählung ihrer Traditionen, Werte und Unternehmenskultur verkauft sich ein weiteres Mal. Blieben diese Informationen abstrakt und würde mir bloß erzählt werden, es sei ein guter Zitronenlikör, wäre ich vorbeimarschiert.
Es mag schon eine gewisse Kritik durchgeklungen sein, aber ich denke, ich benötige ein weiteres Beispiel zur Verdeutlichung dieser besonderen Dynamik der Verschleierung. Wir erfahren die Geschichte moderner Unternehmen, deren Teil des Storytellings ist, ihre Mitarbeiter*innen besonders gut zu behandeln, wodurch die Zufriedenheit dieser im Unternehmen als Tugend gilt. Im Pausenraum stehen Billardtische, eine Mahlzeit ist inklusive, die große Siebträgermaschine scheint das Zentrum des Büros zu sein, in den Pausen oder vor der Schicht wird die Spielekonsole malträtiert und nach der Arbeit geht die erste Runde in der nächstgelegenen Bar auf den*die wie ein*e Freund*in wirkende*r Arbeitgeber*in. Rundum eine angenehme Unternehmenskultur, die gerne als äußerliche Narration verkauft werden darf? Ein kleines Detail wird in dieser Geschichte nicht erzählt: Diese Jobs bieten im Schnitt eine vierundzwanzig Prozent schlechtere Bezahlung als ihre Kontrahenten. Eine scheinbar bessere Unternehmenskultur als eine Strategie der Selbsterhebung hört allerdings nicht dort auf. Die meisten diesbezüglichen Praktiken fokussieren sich auf die Vereinnahmung des Privaten. Das Unternehmen gestaltet die Zeit vor der Arbeit, die während der eigenen Pause und die nach dem Arbeitstag meist so, dass arbeitsbezogene Themen auch hier ihre Zeit finden. Das gemeinsame Spielen der Spielekonsole, vor der Arbeit gewöhnt einen an den Arbeitsplatz. Das gemeinsame Mittagsessen auf Firmenkosten kommt einem Meeting mit den Kollegen gleich. Das abendliche Feierabendbier lässt den Tag Revue passieren, und auch sind die Gesprächsthemen mit den Kolleg*innen vorbestimmt. All dies auf Kosten der geringer-entlohnten Arbeitnehmer, die der sozial-konstruierten These unterliegen, Arbeitsklima sein wichtiger als Gehalt. Teil der Realität ist, dass die Wahrnehmung der Mitarbeiter*innen zu sein scheint, dass ihnen eine wohlige Atmosphäre wichtiger ist, als die nächste Gehaltserhöhung. Dies spielt selbstverständlich den Arbeitgebern in die Hände, deren steigende Gewinne und deren nicht vorhandene Umlage nicht intern gerechtfertigt werden muss. Dieser vom Arbeitnehmer*innen erwirtschaftete Übergewinn wird nicht ausgeschüttet und dieser seiner Arbeitskraft weiter entfremdet.
Ich möchte an dieser Stelle nochmal deutlich machen, dass ich Narrative beziehungsweise das narrative Erzählen für normativ-indifferent halte. Ihr Anwendungsbereich reicht von zutiefst faschistischen Weltbildern, über Marktideologie bis hin zu einem sinnstiftenden gesellschaftlichen Fortschritt hin zu einer aufgeklärten Welt. Geschichten und ihre Bedeutung sind schon immer Teil der Narration Menschheit. Geschichten ermöglichen uns, die Welt zu verstehen. Gerade ihre Informalität und ihre Zugänglichkeit lädt kulturprägende Narrative ein, und sie besitzen hierdurch eine besondere Rolle in Gesellschaft. Diese kulturelle Praxis des narrativen Erzählens benötigt keine wissenschaftliche Stichhaltigkeit für ihren Erfolg, sondern die Vermittelbarkeit des Narrativen liegt ihrer Anerkennung zugrunde, weshalb sie für Missbrauch so anfällig ist.
Um nun auch einen versöhnenden Ton anzustimmen, dem ich eigentlich, aufgrund einer neugewonnenen Sympathie für eine Form der bewussten Unangepasstheit versuchen wollte, zu entwachsen: Diesem Missbrauch sollte Gebrauch entgegengesetzt werden. Dies ist schon seit den 1990ern Teil der feministischen Theorie. Die Gründermutter der feministischen Methode der Radikalfeministin Catherine MacKinnon, deren Theoriekonstrukt – nicht wegen ihrer Grundfesten, sondern aufgrund ihres toten Winkels für die Intersektionalität von Diskriminierung – kritisiert wurde, schaffte den Anstoß für den Ausdruck der Selbsterfahrung als ein erkenntnistheoretisches Modell. So soll zum Beispiel in der Auslegung Angela P. Haris, Expertin für „Critical Race Theory“ und feministische Rechtsphilosophie, gerade die Fähigkeit, die eigene Geschichte zu erzählen, die Möglichkeit bieten, ein Verständnis für das eigene interkulturelle Ringen mit der einen umgebenden Gesellschaft zu artikulieren. So sollen wir ein Verständnis für die Vielseitigkeit des Bewusstseins generieren. Diese Akkumulation von Biografien und ihre Exegese ermöglicht es, ein Verständnis anderer Lebenswelten sichtbar zu machen und diese, im Sinne der Rechtsphilosophie, in Gesetz zu gießen. Sie erlauben uns nicht bloß, andere Lebensentwürfe wahrzunehmen, sondern im Prozess des Lesens regen sie unsere Empathie an, und bilden diese gar weiter aus. Ein nahezu humanistischer Ansatz.
Geschichten und ihre Narrative haben eine gesellschaftlich-revolutionäre
Sprengkraft. Das Problem, dass keine Stichhaltigkeit für sie vonnöten, sondern
ihre Vermarktbarkeit das Zentrum ihrer Verführungskraft ist, hat zur Folge,
dass sie zum Gebrauchsgegenstand demokratiefeindlicher Ideologien werden. Somit
enden wir – nach einer langen autobiografischen, belanglosen, nahezu
marxistischen oder theoretisch-feministischen Analyse, in einem bemüht-komplexen
Duktus – mit einem nahezu kitschigen, aber nicht unwichtigen Apell, inzwischen
weit entfernt von meiner anfänglichen Selbsteinschätzung, meinem Narrativ: Lernt
Geschichten zu erzählen, und ladet sie mit Bedeutung auf. Lernt Geschichten zu
erzählen, um die Narrative dieser Welt nicht den Feinden der Demokratie
preiszugeben. Lernt Geschichten zu erzählen, um sie nicht ihrer Vermarktbarkeit
zu überlassen. Lernt Geschichten zu erzählen, um die Narrative zum Gelingen des
gesellschaftlichen Miteinanders mitbestimmen zu dürfen. Und lest.
Text- und Bilderechte: Marcel Guthier.