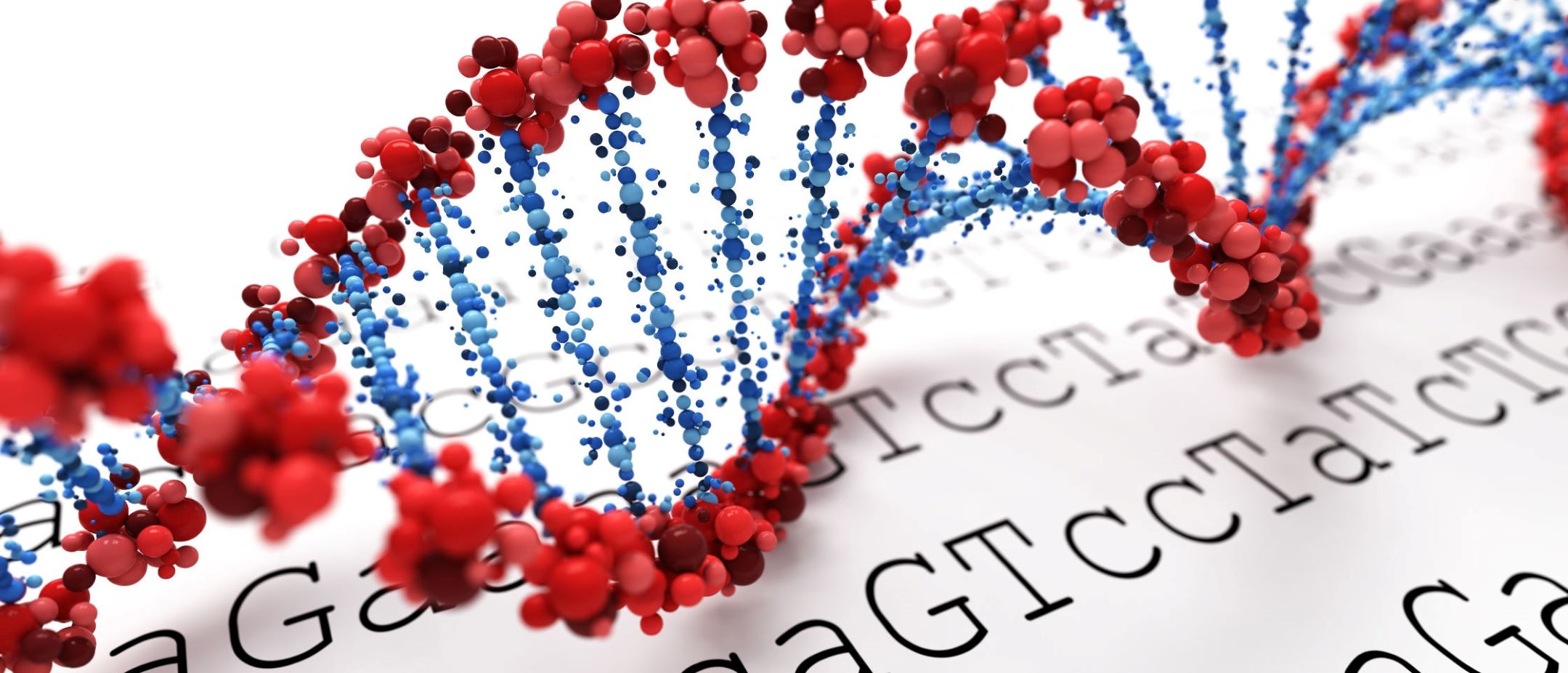Zur Krebserkrankung kam es nach den Ergebnissen neuer Genomanalysen in Science (2021; DOI: 10.1126/science.abg2538), weil bekannte Signalwege von Onkogenen aktiviert wurden, die heute Ansatzpunkte für zielgerichtete Medikamente sind.
Eine weitere Analyse in Science (2021; DOI: 10.1126/science.abg2365) fand 35 Jahre nach dem Reaktorunglück keine Hinweise, dass Keimbahnschäden bei den Überlebenden Liquidatoren das Erkrankungsrisiko der Kinder erhöht haben.
Der Anstieg der papillären Schilddrüsenkarzinome, zu dem es nach dem 26. April 1986 in der Umgebung von Tschernobyl kam, wird vor allem auf die Exposition mit dem Isotop Jod-131 zurückgeführt, das über pflanzliche Nahrungsmittel und die Milch von Kühen in die Nahrungskette gelangte. Ein kausaler Zusammenhang wurde durch das junge Erkrankungsalter der Patienten deutlich.
Ein Team um Lindsay Morton hat jetzt die Genome von 359 Karzinomen untersucht, die bei jüngeren Menschen aufgetreten waren, die 1986 als Kind erhöhte Mengen Jod-131 aufgenommen hatten. Die Forscher suchten dabei nach möglichen genetischen Markern, die die strahleninduzierten Karzinome von anderen unterscheiden.
Der Vergleich mit papillären Schilddrüsenkarzinomen bei Patienten, die nach 1986 geboren wurden, ergab jetzt überraschenderweise, dass die Zahl der Punktmutationen nicht erhöht war. Stattdessen fanden sich Hinweise auf Doppelstrangbrüche, was gegenüber einer einzelnen Mutation der größere Schaden ist.
Bei der Reparatur von Doppelstrangbrüchen kommt es häufiger zu Fehlern. Dies gilt insbesondere für die DNA-Reparatur durch nicht-homologe Endverknüpfung. Dabei kommt es häufiger zu einem Verlust von Genen und durch das Zusammenfügen der Enden können durch Genfusionen sogenannte „Treibermutationen“ entstehen. Dies war auch bei den Jod-131-exponierten Kindern der Fall. Bei etwa 95 % der Tumore konnten die US-Forscher die „Fusionstreiber“ nachweisen.
Fast alle Onkogene waren im MAP-Kinase-Signalweg aufgetreten. Zu dieser Gruppe gehören auch die Onkogene BRAF, RAS und RET, die Ärzten vertraut sind, da sie heute ein Ansatzpunkt für gezielte Krebsmedikamente sind. Die Studie deutet darauf hin, dass „Fusionstreiber“ spezifisch für durch Strahlung induzierte Krebserkrankungen sein könnten, während Punktmutationen eher andere Ursachen haben. Dies dürfte jedoch vorerst eine Hypothese bleiben, da nur eine Krebsform untersucht wurde, die von einem einzigen Isotop ausgelöst wurde. Krebserkrankungen durch andere Strahlenschäden könnten andere Mechanismen zugrunde liegen.
In einer 2. Studie ist das Team um Morton der Frage nachgegangen, ob die Strahlenschäden auf die nächste Generation weiter vererbt werden. Dies ist möglich, wenn die Strahlenschäden die DNA in den Keimzellen (also Spermatogonien und Oogonien) verändern. Die Forscher haben hierzu das Genom von 130 Personen sequenziert, die nach dem Reaktorunfall geboren wurden und von denen ein Elternteil oder beide als Liquidator an den ersten Aufräumarbeiten beteiligt waren. Diese Personen waren, sofern sie überlebten, einer erhöhten gonadalen Strahlendosis ausgesetzt.
Da die Liquidatoren Dosimeter bei sich trugen, konnten die Forscher ermitteln, ob es dosisabhängig zu einer erhöhten Zahl von De-novo-Mutationen gekommen ist. Dafür wurden keine Hinweise gefunden, obwohl die Liquidatoren teilweise sehr hohen Strahlendosen ausgesetzt waren.
Tierexperimentelle Studien hatten ergeben, dass die Strahlung zu einer erhöhten Rate von De-novo-Mutationen beim Nachwuchs führt. Dies war bei den Kindern der Liquidatoren jedoch nicht nachweisbar. Der Grund für die Diskrepanz ist nicht klar. Da die meisten Kinder erst viele Jahre nach der Exposition gezeugt wurden, könnten vorher in den Keimzellen viele Schäden von der DNA-Reparatur behoben worden sein, vermutet Morton.
rme/aerzteblatt.de
Grafik: /Leigh Prather, stockadobecom